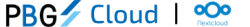Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist wesentliche Säule der Alterssicherung, konnte aber trotz vieler Bestrebungen in Politik und Praxis bislang nicht die gewünschte Verbreitung erzielen. Das zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz soll dies ändern. Nach dem Ampel-Aus 2024 ist es nun zurück.
Die Politik widmete sich der Problematik bereits im vergangenen Jahr mit dem vom Bundestag verabschiedeten Gesetzentwurf zum zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II). Dieser war Hoffnungsträger für eine bessere Verbreitung der bAV, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie unter Geringverdienern. Das Koalitionsende 2024 verhinderte zunächst ein Inkrafttreten. Dieses Jahr wurde ein in weiten Teilen unveränderter Gesetzentwurf erneut ins Gesetzgebungsverfahren geeben. Am 03.09.2025 beschloss das Kabinett dann den Regierungsentwurf des neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz II.
Damals und heute
Die Gesetzesreform sah bereits in 2024 insbesondere Änderungen am sog. Sozialpartnermodell (SPM) vor, die es nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, in KMU häufig vorkommend, ermöglichen sollten, auch an nicht einschlägige SPMe anzudocken und somit eine bAV zu implementieren.Zudem beinhaltete der Entwurf die Ausweitung der Förderung von Geringverdienern nach § 100 EStG und die Möglichkeit die arbeitnehmerfinanzierte bAV zu stärken, indem Opting-Out-Modelle nunmehr auf Basis von Betriebsvereinbarungen ermöglicht werden sollten, was bislang nur mit tarifvertraglicher Grundlage möglich ist. Letztlich sollten mit dem BRSG II auch Verwaltungserleichterungen erzielt werden, beispielsweise durch die Ausweitung der Abfindungsmöglichkeiten in der bAV.
Ausblick nach dem Ampel-Aus im November 2024
Die Reformvorschläge waren das Ergebnis enger Zusammenarbeit von Ministerien, Aufsicht, Sozialpartnern und Praktikern der bAV. Der Bundesrat hatte dem Gesetzesentwurf ebenfalls bereits zugestimmt. Es kam jedoch nicht mehr zum Inkrafttreten des Gesetzes. Experten sahen weiterhin die Notwendigkeit einer alsbaldigen Umsetzung der beabsichtigten Regelungen. Auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ist das Ziel der Stärkung der betrieblichen Altersversorgung weiter verankert. Arbeits- und Finanzministerium haben das BRSG II 2025 erneut auf den Weg gebracht, in weitestgehend unveränderter Form. Ende Juli ging ein neuer Referentenentwurf in die Verbändeanhörung. Am 3. September 2025 hat nun die Bundesregierung den Regierungsentwurf beschlossen. Dieser muss fortan den Bundesrat passieren. Das Gesetz soll noch dieses Jahr verabschiedet werden und in Teilen zum 01.01.2026 in Kraft treten.
Das Wesentliche auf einen Blick
Sozialpartnermodell
Teil der Gesetzesreform sind Änderungen am sog. Sozialpartnermodell (SPM). Ein Sozialpartnermodell ist eine ausschließlich zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte bAV ohne festes Leistungsversprechen. Arbeitgeber sind damit weitgehend von der Haftung befreit. Sie stellen lediglich den Beitrag zugunsten der betrieblichen Vorsorge bereit (pay and forget). Mit der Änderung soll es nunmehr auch bei fehlender Tarifbindung den Unternehmen ermöglicht werden, an nicht einschlägige SPMe anzudocken, insbesondere, wenn in einem branchenfremden Bereich, der an sich für das Arbeitsverhältnis zuständigen Gewerkschaft, bereits ein SPM geschlossen wurde. Daneben soll ein Andocken möglich sein, wenn ein für das Arbeitsverhältnis einschlägiger Tarifvertrag dies eröffnet oder die Arbeitnehmer, bei Tarifvertragsparteien beschäftigt sind, die einen Tarifvertrag über ein Sozialpartnermodell abgeschlossen haben. Hier kann dann die Teilnahme an dem Sozialpartnermodell vereinbart werden. Voraussetzung ist, dass die das SPM tragenden Tarifvertragsparteien dem Anschluss zustimmen. Bessere Chancen hätte die Reform, wenn sichergestellt wäre, dass KMU auch Zugang zu einem SPM erhalten, wenn im Organisationsbereich der zuständigen Gewerkschaft noch kein SPM geschlossen wurde. Seit Einführung des SPM mit dem BRSG I konnten sich diese Modelle kaum durchsetzen.
Opting-Out auf Betriebsebene
Das Ziel, die durch Entgeltumwandlung finanzierte bAV zu stärken, indem Opting-Out-Modelle nunmehr auch ein auf Basis von Betriebsvereinbarungen ermöglicht werden, ist ausdrücklich zu begrüßen. Mit diesen würden Arbeitnehmer automatisch in ein eigenfinanziertes bAV-System aufgenommen werden, es sei denn, sie widersprechen der Teilnahme. Arbeitgeber müssten einen Zuschuss von 20 % leisten, auch im Durchführungsweg der Direktzusage. Bislang sind Opting-Out-Modelle nur mit tarifvertraglicher Grundlage realisierbar. Voraussetzung ist bislang, dass, entweder ein Tarifvertrag selbst das Opting-Out vorsieht oder sich in einem Tarifvertrag eine entsprechende Öffnung für ein Opting-Out auf Betriebsebene findet. Das Erfordernis soll mit dem Gesetzentwurf weitestgehend entfallen. Vorgesehen ist aber auch, dass Opting-Out Modelle auf Betriebsebene ohne tarifvertragliche Regelung nur dann etabliert werden können, wenn die Entgeltansprüche, über die verfügt wird, nicht und nicht üblicherweise in einem einschlägigen Tarifvertrag geregelt sind oder werden.Das dürfte jedoch allermeistens der Fall sein.
Geringverdienerförderung
Auch die Ausweitung der Arbeitgeber(!)-Förderung einer bAV für Geringverdiener nach § 100 EStG ist ein wichtiger Schritt zur Verbreitung der bAV. Arbeitgeber erhalten bislang einen Förderbetrag für einen bAV-Beitrag an ihre Beschäftigten, die monatlich nicht mehr als 2.575 € brutto verdienen. Der förderfähige Betrag beträgt 960 €, auf den der Arbeitgeber 30% über die Lohnsteueranmeldung erstattet erhält.
Ziel des Gesetzes ist, die Einkommensgrenze von derzeit noch .2575€ zu dynamisieren. Sie soll fortan bei 3% der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung liegen. Daneben soll der förderfähige Betrag von 960€ auf 1200€ erhöht werden.
Größere Hebelwirkungen wären möglich, wenn neben der angedachten Anhebung und Dynamisierung der Einkommensgrenze sowie der Erhöhung des Förderhöchstbetrags auch eine Erhöhung des Fördersatzes angestrengt würde. Dieser bleibt jedoch unverändert.
Verdopplung der Abfindungsgrenzen
Das Abfindungsrecht der bAV soll ausgeweitet werden. Neben der bislang bestehenden Möglichkeit des Arbeitgebers laufende Renten und unverfallbare Anwartschaften bis zur Höhe von 1% bzw. zwölf Zehntel bei Kapitalleistung der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Sozialgesetzbuchs (in 2025 also 37,45 € für laufende Renten und 4.494 € für Kapitalleistungen) einseitig und damit ohne Zustimmung des Arbeitnehmers abzufinden, soll nunmehr eine Verdopplung dieser Abfindungsgrenzen ins Gesetz aufgenommen werden, wenn die Abfindung zweckgebunden in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wird und der Arbeitnehmer dem zustimmt. Motivation für diese Zweckbindung ist die Aufrechterhaltung der Absicherung und damit der Versorgung im Alter. Mit der Neuregelung soll eine Verwaltungserleichterung und Bürokratieentlastung erzielt werden, denn häufig müssen Unternehmen Kleinstrenten und -anwartschaften bis zum Erlöschen des Anspruchs (z. B. Tod) aufrechterhalten und verwalten. In Folge der Zweckbindung an die DRV Bund und des Zustimmungserfordernisses ist jedoch keine wesentliche administrative Erleichterung zu erwarten.
Fazit
Wie begrüßenes, dass das weitgehend vorbereite Betriebsrentenstärkungsgesetz auch unter der neuen Regierung umgesetzt werden soll. Die Koalition erkennt den Handlungsbedarf in Folge einer stagnierenden zweiten Säule der Alterssicherung in Deutschland und will daran etwas ändern. Wir zeigen uns allerdings skeptisch, ob das proklamierte Ziel der weiteren Verbreitung der bAV mit den Vorhaben des Gesetzes erreicht werden kann. Im Einzelnen sollten Regelungen mehr Flexibilität gewähren z. B. bei den Opting-Out-Modellen auf Betriebsebene. Der nunmehr beschlossene Regierungsentwurf enählt auch wieder eine Evaluierungsklausel hinsichtlich der Verbreitung der bAV, insbesondere mit Hinblick auf die vorgesehene Öffnung der Sozialpartnermodelle.Für den Fall, dass sich die Verbreitung der bAV nicht merklich steigert, könnte die Idee eines bAV-Obligatoriums wieder Auftrieb erhalten.